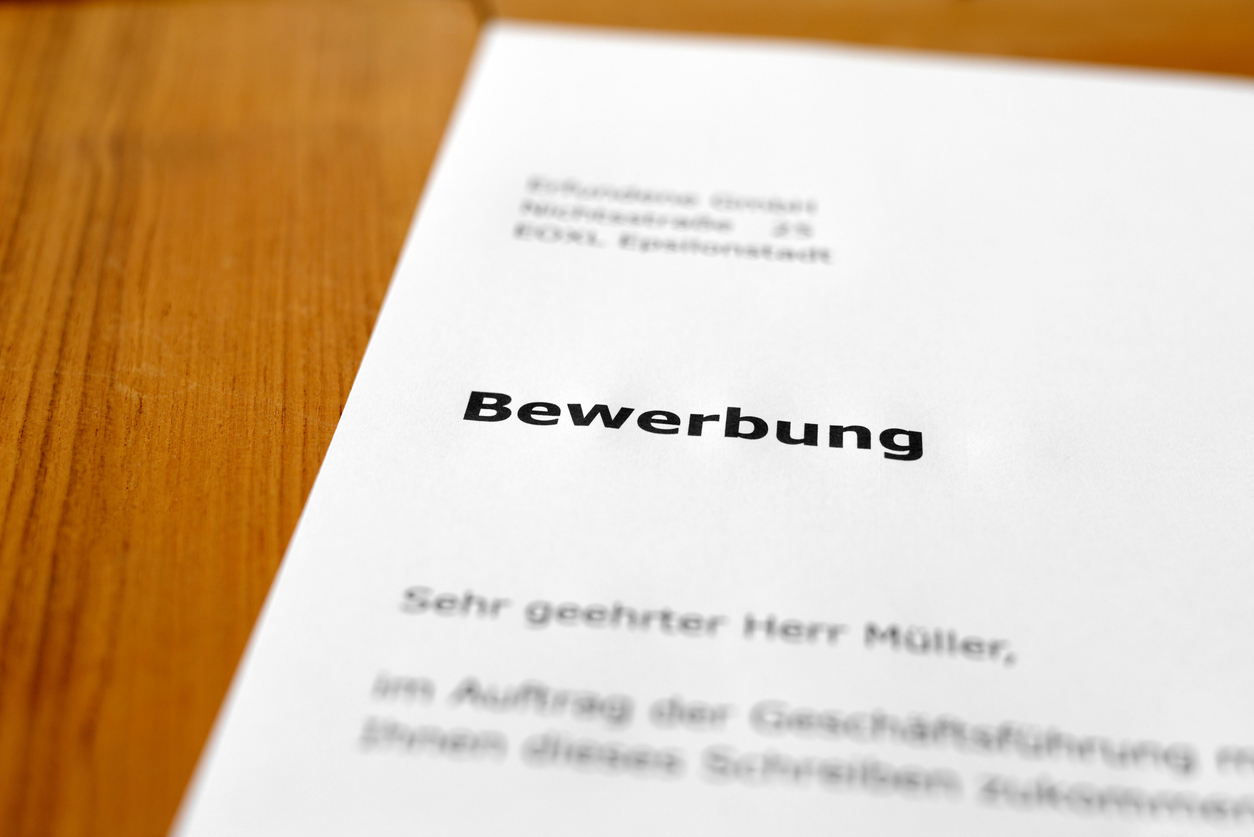Der deutsche Rechtsstaat steht vor einer existenziellen Herausforderung: Bis 2030 werden 40 Prozent der Juristen aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden, während gleichzeitig überlange Verfahrensdauern und unbearbeitete Akten die Funktionsfähigkeit von Justiz und Verwaltung bedrohen. Dr. Carl-Wendelin Neubert identifiziert konkrete Reformansätze, die schnell umsetzbar sind und das Ausbildungssystem modernisieren könnten.
Digitale Revolution als Ausbildungsmotor
Künstliche Intelligenz könnte die juristische Ausbildung revolutionieren und individualisierte Betreuung demokratisieren. Das Bloom'sche 2-Sigma-Problem zeigt: Studierende mit persönlicher Betreuung schneiden besser ab als 98 Prozent derer ohne individuelle Förderung. Generative KI ermöglicht erstmals kostengünstigen Zugang zu dieser Qualität. Neubert schlägt vor, "Chief Digital Officers" an Fakultäten und Ausbildungsgerichten zu etablieren, die digitale Lernelemente integrieren. Universitätsbibliotheken sollten neben Kommentaren auch digitale Lerntools bereitstellen und kritische Auseinandersetzung mit KI-Ergebnissen fördern. Blended Learning, bei dem Lehrveranstaltungen durch digitale Anwendungen ergänzt werden, führt laut Lernforschung zu deutlich besseren Ergebnissen.
Strukturelle Schwächen im Prüfungssystem beseitigen
Das aktuelle Korrektursystem weist gravierende Mängel auf: Eine Studie aus 2024 belegt bei identischen Klausuren Notenabweichungen von durchschnittlich 6,47 Punkten zwischen verschiedenen Korrektoren. Neubert fordert daher eine verdeckte Zweitkorrektur, bei der Zweitkorrektoren die Erstnoten nicht kennen und eigenständige Bewertungen abgeben. Ähnlich problematisch ist die Vornotenkenntnis in mündlichen Prüfungen, die zu systematischen Verzerrungen führt. Prüfungskommissionen orientieren sich unbewusst an schriftlichen Vornoten statt eigenständiger Bewertung der mündlichen Leistung. Die Abschaffung dieser Kenntnis würde Objektivität steigern und nachgewiesene Ungleichbehandlungen reduzieren.
Passauer Modell als Vorbild für Staatsexamensvorbereitung
Das Problem der unzureichenden Staatsprüfungsvorbereitung zeigt sich darin, dass 70-90 Prozent der Studierenden an staatlichen Fakultäten private Repetitorien besuchen müssen. Die Universität Passau demonstriert eine Alternative: Durch Lehrprofessuren mit überwiegender Lehrverpflichtung bewältigen über 85 Prozent der Studierenden das erste Staatsexamen ohne externe Hilfe. Diese Professuren besetzen didaktisch herausragende Persönlichkeiten, deren Dienstaufgabe primär in der Lehre liegt – ein Modell, das systematisch an anderen Fakultäten implementiert werden könnte.
Referendariatsreform durch Standardisierung und Digitalisierung
Das Referendariat leidet unter qualitativ unterschiedlicher Ausbildung, abhängig von individuellen Ausbilderfähigkeiten. Nordrhein-Westfalen entwickelt bereits einheitliche Ausbildungsunterlagen für alle Stationen außer der Anwaltsstation, um zentral Qualitätsstandards zu gewährleisten. Besonders problematisch sind die rechtsanwaltlichen Arbeitsgemeinschaften: Brillante Anwälte haben meist zu wenig Zeit und Anreize für Ausbildungstätigkeit. Neubert schlägt deren komplette Abschaffung zugunsten hochwertiger digitaler Schulungseinheiten vor, entwickelt in Kooperation mit Bundesrechtsanwaltskammer und Deutschem Anwaltverein.
Widerstand gegen Status quo überwinden
Reformblockaden entstehen oft durch Verharmlosung der Probleme oder Schuldzuweisungen an Studierende. Die Justizministerkonferenz erklärte 2024 ohne repräsentative Datengrundlage, dass "grundlegender Reformbedarf nicht besteht" – eine Haltung, die dem Rechtsstaat schadet. Fortschritt hängt derzeit von einzelnen "Champions" ab, die Veränderungen gegen institutionellen Widerstand erkämpfen müssen. Manche Bundesländer verschlechtern sogar die Bedingungen: NRW opferte ein Drittel der Referendariatsplätze dem Sparzwang.
Gesamtgesellschaftliche Konsequenzen der Reformverweigerung
Ausbleibende Reformen bedrohen nicht nur den Rechtsstaat, sondern auch Deutschlands Wirtschaftsstandort. Endlose Gerichts- und Genehmigungsverfahren durch Personalmangel vertreiben Investitionen und Wertschöpfung.
Studien von iur.reform, RefKo und dem Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften dokumentieren unfaire Prüfungsbedingungen, psychischen Druck und unzureichende Examens-vorbereitung als Hauptgründe für Studienabbrüche. Neubert betont: Sinnvolle Reformen zielen nicht auf Niveauabsenkung, sondern auf bessere Vorbereitung für anspruchsvolle Staatsprüfungen und berufliche Anforderungen. Bundesländer und Fakultäten, die mutig vorangehen, werden im Wettbewerb um juristische Talente profitieren. Der Deutsche Anwaltstag 2025 widmet sich gezielt diesem Thema – ein Hoffnungsschimmer für überfällige Reformen.
Related articles
Current vacancies
Most read articles
Discover more topics
Our partners
Discover exclusive jobs nationwide with us at:


Discover exclusive jobs nationwide with us at:


Discover exclusive jobs nationwide with us at:


Discover exclusive jobs nationwide with us at:


Discover exclusive jobs nationwide with us at: